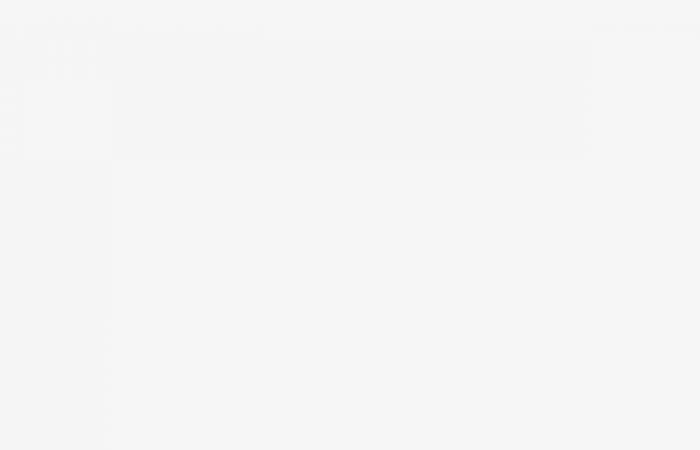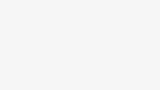BBC
BBCBoxing Day 2004.
Als das Erdbeben um 06:30 Uhr (01:00 GMT) ausbrach, befand ich mich auf einer Fähre in Richtung Havelock – einer Insel im indischen Archipel der Andamanen und Nikobaren.
Der Strand von Radhanagar ist für seinen silbernen Sand und das klare blaue Wasser bekannt und wurde kürzlich vom Time Magazine zum „besten Strand Asiens“ gekürt.
Meine beste Freundin vom College und ihre Familie lebten seit anderthalb Jahrzehnten in Port Blair, der Hauptstadt des Archipels, aber dies war mein erster Besuch auf den Inseln, wo ich an Heiligabend angekommen war.
Wir hatten geplant, drei Tage in Havelock zu verbringen, und am Morgen packten wir Snacks und Sandwiches, versammelten aufgeregte Kinder und machten uns auf den Weg, um die Fähre vom Phoenix Bay-Anleger in Port Blair zu nehmen.
Da ich nichts verpassen wollte, stand ich auf dem Vorderdeck und schaute mich um, als die Katastrophe geschah.
Gerade als wir den Hafen verließen, geriet das Boot ins Wanken, und plötzlich brach der Steg neben der Stelle zusammen, an der wir an Bord gegangen waren, und fiel ins Meer. Es folgten der Wachturm und ein Strommast.
Es war ein außergewöhnlicher Anblick. Dutzende Menschen, die neben mir standen, sahen mit offenem Mund zu.
Zum Glück war der Steg zu diesem Zeitpunkt verlassen, sodass es keine Verletzten gab. Von dort sollte in einer halben Stunde ein Boot abfahren, aber die Reisenden waren noch nicht angekommen.
 Getty Images
Getty ImagesEin Mitglied der Bootsbesatzung sagte mir, es handele sich um ein Erdbeben. Damals wusste ich es nicht, aber das Beben der Stärke 9,1 war das drittstärkste jemals auf der Welt aufgezeichnet wurde – und es bleibt das größte und zerstörerischste in Asien.
Er ereignete sich vor der Küste im Nordwesten Sumatras im Indischen Ozean und löste einen verheerenden Tsunami aus, der schätzungsweise 228.000 Menschen in mehr als einem Dutzend Ländern tötete und massive Schäden in Indonesien, Sri Lanka, Indien, den Malediven und Thailand anrichtete.
Die Andamanen- und Nikobareninseln, die etwa 100 km nördlich des Epizentrums liegen, erlitten erhebliche Schäden, als eine Wasserwand, die stellenweise bis zu 15 Meter (49 Fuß) hoch war, nur etwa 15 Minuten später auf Land traf.
Die offizielle Zahl der Todesopfer wurde auf 1.310 geschätzt – aber bei mehr als 5.600 vermissten und vermutlich toten Menschen geht man davon aus, dass mehr als 7.000 Inselbewohner umgekommen sind.
Während wir auf dem Boot waren, waren wir uns des Ausmaßes der Zerstörung um uns herum nicht bewusst. Unsere Mobiltelefone funktionierten auf dem Wasser nicht und wir bekamen von der Crew nur bruchstückhafte Informationen. Wir hörten von Schäden in Sri Lanka, Bali, Thailand und den Malediven – und der südindischen Küstenstadt Nagapattinam.
 Getty Images
Getty ImagesEs gab jedoch keine Informationen über Andamanen und Nikobaren – eine Ansammlung von Hunderten von Inseln, die im Golf von Bengalen verstreut sind und etwa 1.500 km (915 Meilen) östlich des indischen Festlandes liegen.
Nur 38 davon waren bewohnt. Sie waren die Heimat von 400.000 Menschen, darunter sechs Jäger-Sammler-Gruppen, die seit Jahrtausenden isoliert von der Außenwelt lebten.
Die einzige Möglichkeit, zu den Inseln zu gelangen, waren Fähren, doch wie wir später erfuhren, waren schätzungsweise 94 % der Anlegestellen in der Region beschädigt.
Das war auch der Grund, warum wir es am 26. Dezember 2004 nie nach Havelock geschafft haben. Der Steg dort sei beschädigt und unter Wasser, hieß es.
Also drehte das Boot um und trat die Rückfahrt an. Eine Zeit lang gab es Spekulationen darüber, dass wir aus Sicherheitsgründen möglicherweise keine Genehmigung zum Anlegen in Port Blair erhalten würden und möglicherweise die Nacht vor Anker verbringen müssten.
Das machte den Passagieren – die meisten von ihnen Touristen, die sich auf Sonne und Strand freuten – Angst.
 Getty Images
Getty ImagesNachdem wir mehrere Stunden lang in rauer See dahingeschaukelt waren, kehrten wir nach Port Blair zurück. Da Phoenix Bay nach den Schäden am Morgen geschlossen war, wurden wir nach Chatham gebracht, einem anderen Hafen in Port Blair. Der Steg, an dem wir abgesetzt wurden, hatte stellenweise riesige, klaffende Löcher.
Als wir uns auf den Heimweg machten, waren überall um uns herum Zeichen der Verwüstung zu sehen – Gebäude waren in Schutt und Asche gelegt, kleine umgedrehte Boote standen mitten auf der Straße und die Straßen hatten große Risse. Tausende Menschen wurden obdachlos, als die Flutwelle ihre Häuser in tiefer gelegenen Gebieten überschwemmte.
Ich traf ein traumatisiertes neunjähriges Mädchen, dessen Haus mit Wasser gefüllt war, und sie erzählte mir, sie wäre fast ertrunken. Eine Frau erzählte mir, dass sie im Handumdrehen ihr gesamtes Hab und Gut verloren hatte.
 Getty Images
Getty ImagesIn den nächsten drei Wochen berichtete ich ausführlich über die Katastrophe und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung.
Es war das erste Mal, dass ein Tsunami solch verheerende Schäden auf den Andamanen und Nikobaren verursachte, und das Ausmaß der Tragödie war überwältigend.
Salzwasser verunreinigte viele Süßwasserquellen und zerstörte große Teile des Ackerlandes. Es war schwierig, lebenswichtige Vorräte auf die Inseln zu bringen, da die Anlegestellen unbrauchbar waren.
Die Behörden führten große Hilfs- und Rettungsmaßnahmen durch. Heer, Marine und Luftwaffe waren im Einsatz, doch es dauerte Tage, bis sie alle Inseln erreichen konnten.
Jeden Tag brachten Schiffe der Marine und der Küstenwache Schiffsladungen mit Menschen, die durch den Tsunami obdachlos geworden waren, von anderen Inseln nach Port Blair, wo Schulen und Regierungsgebäude in Notunterkünfte umgewandelt wurden.
Sie brachten Geschichten über die Verwüstung aus ihren Heimatländern. Viele erzählten mir, dass sie nur mit der Kleidung, die sie am Leib trugen, davongekommen seien.
Eine Frau aus Car Nicobar erzählte mir, dass bei dem Erdbeben gleichzeitig mit den Wellen, die vom Meer kamen, schaumiges Wasser aus dem Boden zu spucken begann.
Sie und Hunderte andere aus ihrem Dorf hatten 48 Stunden lang ohne Nahrung und Wasser auf Retter gewartet. Sie sagte, es sei ein „Wunder“, dass sie und ihr 20 Tage altes Baby überlebt hätten.
Port Blair wurde fast täglich von Nachbeben erschüttert, von denen einige stark genug waren, um Gerüchte über neue Tsunamis aufkommen zu lassen, was die verängstigten Menschen dazu veranlasste, auf höher gelegenes Gelände zu rennen.
 Getty Images
Getty ImagesEin paar Tage später flog das indische Militär Journalisten nach Car Nicobar, einer flachen, fruchtbaren Insel, die für ihre bezaubernden Strände bekannt ist und auch die Heimat einer großen indischen Luftwaffenkolonie ist.
Der Killer-Tsunami hatte die Basis völlig dem Erdboden gleichgemacht. Das Wasser stieg hier um 12 Meter und während die meisten Menschen schliefen, wurde ihnen der Boden unter den Füßen weggezogen. Hundert Menschen starben hier. Mehr als die Hälfte waren Luftwaffenoffiziere und ihre Familien.
Wir besuchten die Dörfer Malakka und Kaakan auf der Insel, die ebenfalls die Hauptlast der Naturgewalt trugen und die Bewohner dazu zwangen, in Zelten entlang der Straße Zuflucht zu suchen. Unter ihnen waren Familien, die von der Flutwelle auseinandergerissen wurden.
Ein trauerndes junges Paar erzählte mir, dass es ihnen gelungen sei, ihr fünf Monate altes Baby zu retten, aber ihre anderen Kinder im Alter von sieben und zwölf Jahren wurden weggespült.
Von allen Seiten von Kokospalmen umgeben, war jedes Haus in Schutt und Asche gelegt. Zu den verstreuten persönlichen Gegenständen gehörten Kleidung, Lehrbücher, ein Kinderschuh und ein Musikkeyboard.
Das Einzige, was überraschend unversehrt stand, war eine Büste des Vaters der indischen Nation, Mahatma Gandhi, an einem Verkehrskreisel.
 Getty Images
Getty ImagesEin hochrangiger Armeeoffizier erzählte uns, sein Team habe an diesem Tag sieben Leichen geborgen, und wir beobachteten die Massenverbrennung aus der Ferne.
Auf dem Luftwaffenstützpunkt sahen wir zu, wie Retter die Leiche einer Frau aus den Trümmern hoben.
Ein Beamter sagte, dass von jeder Leiche, die in Car Nicobar gefunden wurde, mehrere von den Wellen weggeschwemmt worden seien, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Nach all den Jahren denke ich immer noch manchmal an den Tag, an dem ich mit der Fähre nach Havelock fuhr.
Ich frage mich, was passiert wäre, wenn das Zittern ein paar Minuten früher gekommen wäre.
Und was wäre passiert, wenn die Wasserwand das Ufer getroffen hätte, während ich am Steg darauf wartete, an Bord unserer Fähre zu gehen?
Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 war es für mich knapp. Tausende, die umkamen, hatten nicht so viel Glück.
Folgen Sie BBC News India auf Instagram, YouTube, Twitter Und Facebook.